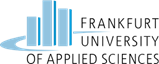Transformationswissen für die Katastrophenhilfe
Transformationswissen für die Katastrophenhilfe
Im deutschsprachigen Raum findet eine sozialarbeiterische Katastrophenhilfe noch zu geringe Beachtung. Zugleich treten (klima- und naturbedingte) Katastrophen global wie auch hierzulande häufiger auf, mit eklatanten (psycho-)sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Folgen für Menschen und Gemeinwesen. Für eine forschungsbasierte Weiterentwicklung der sozialarbeiterischen Katastrophenhilfe wählt das Forschungsprojekt „Transformationswissen für die Kastastrophenhilfe“ die von der Flutkatastrophe 2021 betroffenen Gebiete im Ahrtal und der (West-)Eifel als Reallabor. In einem Netzwerk mit Praxispartnern werden die Auswirkungen der Flutkatastrophe aus einem zukunftsgerichteten, die Resilienz fördernden Blick erforscht.
Der partizipative Forschungszugang geht davon aus, dass Betroffene von Katastrophen über Transformationswissen verfügen, um Orte, Städte und Regionen resilienter im Umgang mit Katastrophen zu machen. Erforscht werden insbesondere das Erleben und die Bewältigungsstrategien der Bevölkerung, involvierter Fachkräfte aus dem Bereich der Sozialen Arbeit, der Zivilgesellschaft, des Bevölkerungsschutzes sowie von Helfer:innen.
Ziel ist es, das im Forschungsprozess rekonstruierte Wissen als transformatorisches Wissen für die Praxis zu nutzen, um zukünftig den Katastrophenschutz stärker nach den Bedürfnissen von Betroffenen auszugestalten. Der Forschungsfokus liegt u.a. auf Solidaritätserfahrungen und Community-Resilienz mit Blick auf vulnerabilisierte (Bevölkerungsgruppen)Gruppen. Weiterführend wird eine Debatte angestoßen, wie sich die Soziale Arbeit in der Zukunft mehr als bisher als Akteurin in der Katastrophenhilfe sowie der ökosozialen Katastrophenvorsorge etablieren und eine Partnerin im Austausch von sozialen Diensten, Parteienpolitik, Katastrophenämtern und Stadt- und Regionalentwicklung sein kann.
Verbundprojektleitung
T +49 9561 317 656 andrea.schmelz[at]hs-coburg.de
Projektleitung Partner
Projektdauer
01.09.2024 - 31.08.2027Projektpartner
Projektförderung
Förderprogramm
VW-Stiftung - Pioniervorhaben zu "Gesellschaftliche Transformationen"